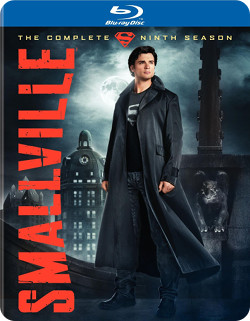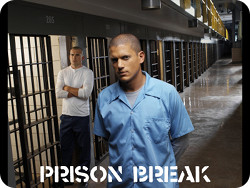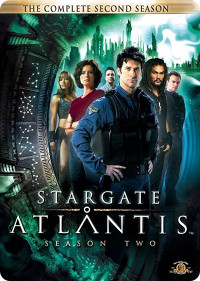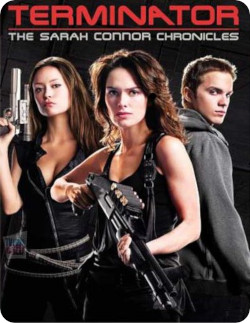 Ein Mann und sein Ergometer kämpfen gegen die Herrschaft der Maschinen. Naja, jedenfalls beobachten wir ihn auf der Mattscheibe. Die eigentlich gar nicht matt ist, sondern glänzt. Stundenlanges Strampeln zwecks Kalorienverbrennung über einen Zeitraum von mehreren Monaten war nötig, doch nun ist meine Fernsehserien-Checkliste um einen Eintrag länger geworden: Die Actionserie „Terminator: The Sarah Connor Chronicles“ ist für mich beendet; nach den einzigen beiden Staffeln, die diese Serie überhaupt zu bieten hat, da sie seinerzeit nach ihrer Laufzeit von 2007 bis 2009 vorzeitig vom Sender abgesetzt wurde, und daher mit einem Cliffhanger endet, der offiziell nie aufgelöst wurde. Wie eben so oft bei TV-Serien.
Ein Mann und sein Ergometer kämpfen gegen die Herrschaft der Maschinen. Naja, jedenfalls beobachten wir ihn auf der Mattscheibe. Die eigentlich gar nicht matt ist, sondern glänzt. Stundenlanges Strampeln zwecks Kalorienverbrennung über einen Zeitraum von mehreren Monaten war nötig, doch nun ist meine Fernsehserien-Checkliste um einen Eintrag länger geworden: Die Actionserie „Terminator: The Sarah Connor Chronicles“ ist für mich beendet; nach den einzigen beiden Staffeln, die diese Serie überhaupt zu bieten hat, da sie seinerzeit nach ihrer Laufzeit von 2007 bis 2009 vorzeitig vom Sender abgesetzt wurde, und daher mit einem Cliffhanger endet, der offiziell nie aufgelöst wurde. Wie eben so oft bei TV-Serien.
Wieder einmal handelt es sich um eine Serie, von der ich viel gehört hatte, und die mir von mehreren Personen ans Herz gelegt wurde, weshalb ich mich nach all den Jahren nun verspätet ins Vergnügen stürzte. Sarah Connor Chronicles spielt zeitlich wenige Jahre nach den Ereignissen von Terminator 2: Sowohl der T-1000 als auch der T-800 sind vernichtet, und auch die Entstehung von Skynet ist abgewendet worden. Der Tag der Abrechnung im Jahr 1997 fällt glücklicherweise aus. Aber Sarah Connor ist mit ihrem Sohn John seit Jahren auf der Flucht, da sie wegen Mordes an dem Cyberdyne-Programmierer Miles Dyson gesucht wird. Ihre schlimmsten Befürchtungen, dass das Unheil nämlich gar nicht aufgehalten, sondern nur verzögert wurde, bewahrheiten sich leider, als John plötzlich in der Schule von einem „Triple-8“ (Terminator Modell T-888) angegriffen wird. Zum Glück taucht aber sofort Hilfe auf: Johns hübsche Klassenkameradin Cameron (offensichtlich benannt nach Terminator-Schöpfer James Cameron) gibt sich rechtzeitig als der nächste Beschützer-Terminator zu erkennen, rettet John das Leben und bekämpft den bösen Blechmann.
Cameron hat für diesen Ernstfall bereits vorgesorgt und aktiviert eine versteckte Zeitmaschine, mit der sie Sarah und John ins Jahr 2007 schleust. Doch unvorhergesehenerweise gelingt es dem Triple-8, ihnen dorthin zu folgen, und so wird die mörderische Hatz fortgesetzt. Schon kurz darauf bekommt das Trio großkalibrige Unterstützung aus der Zukunft von dem Soldaten Derek Reese, dem Bruder des 1984 getöteten Kyle Reese, dem Vater von John. Gemeinsam versucht man, den Maschinen zu entkommen, und gleichzeitig erneut die Geburtsstunde von Skynet zu verhindern, denn die Gruppe erfährt bald, dass ein hochentwickeltes Schachprogramm mit fortgeschrittener künstlicher Intelligenz höchstwahrscheinlich der Anfang vom Ende der menschlichen Zivilisation sein wird.
Die Prämisse der Serie klingt erst einmal gar nicht schlecht und hatte mit Sicherheit viel Potenzial. Leider ist es für TSCC fatal, dass im Verlauf der beiden Staffeln ein Fass nach dem anderen aufgemacht wird, und dann wird leider für keines davon eine Auflösung präsentiert. Stattdessen wird am Ende von Staffel 2 in einem großen Cliffhanger-Finale zu allem Überfluss auch noch eine völlig neue Zeitlinie aufgemacht. Schließlich hängen sämtliche Handlungsstränge irgendwo in der Luft, und der Zuschauer stellt enttäuscht fest, dass Sarah, John, Cameron und Derek in diesen zwei kümmerlichen Staffeln praktisch kaum vom Fleck gekommen sind. Was war denn nun mit dem bösen Schachcomputer? Und was war mit dem mysteriösen Flüssigmetall-Terminator? Wozu sehen wir Episode um Episode „John Henry“ dabei zu, wie er lernt und über Menschen philosophiert? Wer war die „echte“ Cameron in der Zukunft? Was war mit den UFOs? Hat Sarah Connor denn nun Krebs oder nicht? Wohin flieht Dereks Soldaten-Freundin vom Widerstand? Die Liste der unbeantworteten Fragen ist fast endlos. Es ist mehr als deutlich, dass die Autoren das alles in die späteren Staffeln mitnehmen wollten.
Fans von Cameron-Darstellerin Summer Glau kennen diese Situation zufälligerweise bereits von ihrer anderen Kultserie, „Firefly“, bei der die Katastrophe sogar noch schlimmer war: Kaum mehr als ein Dutzend Episoden in einer einzelnen Staffel gab es zu bewundern, dann war sofort Sendeschluss. Dem Zuschauer wurde ein großes Serienuniversum schmackhaft gemacht, viele spannende Charaktere und Ideen etabliert, und gerade dann wenn man endlich richtig drin ist … fertig. Das ist eben der Nachteil bei Serien, die einen Handlungsbogen gleich über mehrere Staffeln hinweg spannen wollen, und dann vom produzierenden Sender viel zu früh den Stecker gezogen bekommen. Ich habe viele andere Serien gesehen, die auf Grund schlechter Quoten vor ihrer Zeit abgesetzt wurden, deren Handlung aber meist stets im Verlauf einer Episode, größtenfalls in einer Staffel komplett abgeschlossen wird. Solche Serien sind dadurch fast immun gegen spontane Planänderungen und lassen die Zuschauer immerhin nicht mit einem leeren Gefühl zurück. Und genau das gleiche Problem hatte ich zuletzt bei „Stargate: Universe“.

Aber ich will nicht alles schlechtreden. Ich kann vielleicht nicht behaupten, ein Fan der Serie geworden zu sein, aber ein bisschen von dem, was ich freudig erwartet hatte, bekam ich dann auch: Ein paar spannende Kämpfe Terminator vs. Terminator, nicht ganz so krachend wie mit Arnold Schwarzenegger, aber allemal gut genug. Lena Headey ist auch ein ganz annehmbarer Ersatz für Linda Hamilton, und Summer Glau verzückt wie erwartet in der Rolle der emotional hölzernen, sozial unbeholfenen Terminator-Teenagerin mit übermenschlicher Körperkraft. Die Effekte sind zugegebenermaßen eher bescheiden, aber dafür kann man sich auf die vielen Dialoge konzentrieren, in denen Sarah ihren Sohn irgendwie immer wieder zur Vorsicht und Wachsamkeit mahnt und John sich um Cameron sorgt. Die Spannungen zwischen den einzelnen Charakteren sind schon eine Menge Stoff für Unterhaltung in TSCC. Dennoch muss ich gestehen, dass ich die allgemeine Faszination selbst als Terminator-Fan nicht so recht nachvollziehen konnte.
Vielleicht liegt es unter anderem daran, dass Edward Furlong bereits auf der Kinoleinwand einen frühjugendlichen John Connor gezeigt hat, der sich als Ausgestoßener, als schwer erziehbares Anarcho-Pflegekind weitestgehend von der Gesellschaft abgekapselt hat, der auf Konformität scheißt, der Bankautomaten knackt, Autos klaut und mit Waffen Umgang hat. Und jetzt steht John Connor an der Schwelle zum Erwachsensein und hat für meine Verhältnisse zuviele unbedeutende Teenager-Probleme. Er achtet auf sein Haarstyling, pflegt sein gefaketes unnahbares Bad Boy Image, sorgt sich um das Wohl seiner Mitschüler und verliebt sich in aufdringliche Highschool-Mädchen. Selbst seine Mutter, die es besser weiß, hat ihre Schwierigkeiten damit, ihm einzutrichtern, dass er kein normaler Teenager ist, sondern ein Soldat in einem Krieg gegen die Maschinen, der unentbehrlich dabei ist, das Ende der Menschheit aufzuhalten. Mein Eindruck ist, John war über diesen Punkt am Ende von Terminator 2 längst hinaus.
Was bleibt ist eine Actionserie, in die man nicht zuviel Zeit investieren muss, die die Terminator-Geschichte ein wenig weitererzählt, aber insgesamt keinen besonders großen bleibenden Eindruck hinterlässt. Für eine Wiederholung reicht es bei mir jedenfalls nicht. Die epische Titelmusik aus den ersten beiden Terminator-Filmen ist jedem Fan sofort präsent, wenn er nur daran denkt. Hier funktioniert der eher schwermütige Soundtrack oder das trockene Intro leider bei weitem nicht so gut, so dass man die Details schnell wieder vergisst. Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, weshalb man das Intro nach ein paar Folgen einfach unter den Tisch fallen gelassen hat. Und ob die kurze Geschichte um die Sarah Connor Chronicles bald überhaupt noch zum Kanon gehört, wird sich zeigen, wenn demnächst Camerons nächstes echtes Terminator-Kapitel (Terminator: Dark Fate) in die Kinos kommt. Von dem ist nämlich bekannt, dass es alle Filme nach T2 ignoriert. Und das ist wahrscheinlich gut so.