Nicht die Schönste im ganzen Land
 Es hätte eine so schöne Kindheit für Prinzessin Snow White (Kristen Stewart) werden können, wenn da nicht plötzlich ihre Mutter gestorben wäre. In der Folge heiratet ihr Vater, König Magnus, die geheimnisvolle Ravenna (Charlize Theron), die er zuvor aus den Fängen dunkler Krieger befreit hatte. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn Ravenna – jetzt Königin – ermordet kurzerhand ihren frisch angetrauten Gemahl, lässt Snow White in einen Turm sperren und reißt die alleinige Gewalt über das gesamte Land an sich. Als die Prinzessin eines Tages volljährig wird, erkennt Ravenna, welche Gefahr das Mädchen für sie darstellt. Doch kurz bevor Ravenna sie töten kann, gelingt es Snow White zu fliehen. Der Huntsman (Chris Hemsworth), ein stadtbekannter Trinker, soll sie aufspüren und zurückbringen, doch stattdessen beschließt er, sie zu beschützen, da sie die einzige ist, die die Schreckensherrschaft ihrer grausamen Stiefmutter beenden kann. Glücklicherweise stehen ihr außerdem ihr Jugendfreund William und einige Zwerge tapfer zur Seite, während Ravennas bösartiger Bruder der Truppe schon dicht auf den Fersen ist.
Es hätte eine so schöne Kindheit für Prinzessin Snow White (Kristen Stewart) werden können, wenn da nicht plötzlich ihre Mutter gestorben wäre. In der Folge heiratet ihr Vater, König Magnus, die geheimnisvolle Ravenna (Charlize Theron), die er zuvor aus den Fängen dunkler Krieger befreit hatte. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn Ravenna – jetzt Königin – ermordet kurzerhand ihren frisch angetrauten Gemahl, lässt Snow White in einen Turm sperren und reißt die alleinige Gewalt über das gesamte Land an sich. Als die Prinzessin eines Tages volljährig wird, erkennt Ravenna, welche Gefahr das Mädchen für sie darstellt. Doch kurz bevor Ravenna sie töten kann, gelingt es Snow White zu fliehen. Der Huntsman (Chris Hemsworth), ein stadtbekannter Trinker, soll sie aufspüren und zurückbringen, doch stattdessen beschließt er, sie zu beschützen, da sie die einzige ist, die die Schreckensherrschaft ihrer grausamen Stiefmutter beenden kann. Glücklicherweise stehen ihr außerdem ihr Jugendfreund William und einige Zwerge tapfer zur Seite, während Ravennas bösartiger Bruder der Truppe schon dicht auf den Fersen ist.
Wer kennt es nicht, das alte Märchen vom Schneewittchen und den sieben Zwergen von den Gebrüdern Grimm, das nicht zuletzt dank Disney wahrscheinlich eines der bekanntesten auf der Welt ist. Seine jüngste cineastische Inkarnation wurde erst vor wenigen Monaten in den deutschen Kinos zelebriert: in Form des zweistündigen Spielfilms „Snow White and the Huntsman“. Regie führte der unerfahrene Rupert Sanders. Als Zuschauer einer solchen Vorstellung erwartet man sicherlich keine handlungstechnischen Überraschungen, da die Geschichte ohnehin bekannt ist, aber vielleicht ist es dem Regisseur sogar gelungen, dem Märchen einige spannende Finessen, einen glänzenden neuen Anstrich, eine ganz andere Perspektive, soviel Tiefgang und so dermaßen vielschichtige Charaktere zu verpassen, dass man das Gefühl bekommt, man habe etwas völlig neues gesehen. Ist der Film am Ende sogar ein bisschen wie „Der Herr der Ringe“ von Peter Jackson?
Eigentlich nicht. Der Film bringt wirklich ein paar frische Ideen ein, so z.B. dass die Stiefmutter mit einem Fluch belegt ist, oder eine trollähnliche Kreatur, die am Rand eines dunklen Waldes haust. Snow White und der Huntsman landen in einem Dorf, in dem nur noch Frauen leben. Snow White begegnet dem Geist des Waldes im Reich der Feen. Fast nichts davon wird eingehend behandelt, immer nur kurz angerissen und dann sofort aus dem Fokus der Handlung verdrängt und nie wieder erwähnt. Man kann sich auch darüber streiten, ob es ein guter Schachzug war, dass Sanders Schneewittchen einen Hauch von Surrealismus verleihen wollte. Ich fand das meistens sehr interessant, wenn es nur nicht so halbherzig umgesetzt worden wäre. Womöglich liegt es an den Schauspielern, dass der Film so flach wirkt.
Da wäre zunächst Kristen Stewart, das etwas an chronischer Ausdrucksschwäche leidende, aber allemal entzückende Twilight-Sternchen. Damit ist sie für diese Rolle bereits ausreichend qualifiziert und füllt diese auch gänzlich aus. Dass es bei Snow White eben nicht allzu sehr „menschelt“, verzeihe ich dem Film wahrscheinlich sogar leichter als wenn ich mich mit dem Gegenteil hätte abfinden müssen. Umso mehr Emotion liefert dafür eine erwartungsgemäß sehr professionelle Charlize Theron: Sie schreit, sie knurrt, sie hat beinahe Schaum vor dem Mund, und im Gegensatz zu Stewart kann sie sogar weinen, ohne dass es aussieht als wären ihre Augen nur ein bisschen undicht. Chris Hemsworth kopiert hier mehr oder weniger exakt seine Paraderolle aus „Thor“, nur eben ohne göttliche Superkräfte. Wohlmeinend unterstelle ich der Castingabteilung hier Absicht, sonst müsste ich mich darüber beklagen wie stumpf er den Huntsman darstellt. Seine Beteiligung garantiert jeder noch so sorgfältig choreografierten Kampfszene die Eleganz einer Kneipenschlägerei. Die anderen Darsteller hinterlassen kaum genug Eindruck, damit es sich lohnen würde, noch genauer darauf einzugehen. Einzig Bob Hoskins als blinder Zwerg war mir sofort sympathisch.
Etwas befremdlich wirkt, wenn es auch kein Problem des Films sondern der Synchronisation ist, die Verwendung des englischen Namens „Snow White“ für Schneewittchen (daran gewöhnt man sich), und (irgendwie konsequenterweise) „Huntsman“. Für deutsche Ohren ist letzteres vielleicht doch ein bisschen ungeschickt, hätte man doch mit Leichtigkeit etwas aus unserer Sprache einsetzen können. Zumindest meine Wenigkeit versteht in komplett deutschen Dialogen, in denen plötzlich vom „Huntsman“ die Rede ist, schon weil der Begriff im gesamten Film pseudonym verwendet wird, gerne mal so etwas wie „Hansmann“ und musste entfernt an einen Hanswurst denken, aber nicht an einen Jäger. Das kann störend sein, muss es aber natürlich nicht.
Fazit: „Snow White and the Huntsman“ ist kein schlechter Film, und es ist auch kein guter Film. Es ist wohl einfach nur ein Film, und er hat sogar seine Momente, z.B. wenn Snow White ihre „Johanna von Orléans“-Phase hat und beritten und in voller Montur ihre heimatliche Burg stürmt. Optisch gibt es an dem Film nichts zu kritisieren und auch der Soundtrack ist unauffällig aber gut. Fans von Charlize Theron werden sämtliche ihrer Szenen lieben. Darüber hinaus, fürchte ich, kann ich mit Lob im Besonderen nicht dienen. Es ist nicht richtig spannend, es gibt keine echte Liebesgeschichte, auch mit allzuviel Humor darf man nicht rechnen, und überhaupt. Andererseits, wer gerade sonst keinen Film und auch nichts wichtigeres zu tun hat, der wird sich ganz passabel unterhalten fühlen, sofern er denn wenigstens die Hauptdarsteller interessant findet.
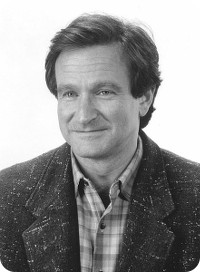


 Vielleicht nicht DIE beste Serie, die ich mir je angesehen habe, aber es reicht locker für meine persönliche Top 3, würde ich sagen: Breaking Bad. Wen man auch fragt, jeder, der die Serie gesehen hat, spricht nur in den höchsten Tönen davon. Nachdem ich zuletzt mit Captain Future eine Reise in die Vergangenheit der Fernsehgeschichte gemacht habe, wollte ich wieder einen Blick in die Gegenwart wagen. Es hat sich nicht einfach nur gelohnt, es hat mich umgehauen. Es folgt ein kurzer Überblick über die Handlung und meine persönlichen Eindrücke, bei dem ich – wie immer – nur soviel über die Handlung vorwegnehme wie nötig, und so vage bleibe wie möglich. Aber die Spoilerwarnung möchte ich dennoch als ernstgemeint betrachtet wissen.
Vielleicht nicht DIE beste Serie, die ich mir je angesehen habe, aber es reicht locker für meine persönliche Top 3, würde ich sagen: Breaking Bad. Wen man auch fragt, jeder, der die Serie gesehen hat, spricht nur in den höchsten Tönen davon. Nachdem ich zuletzt mit Captain Future eine Reise in die Vergangenheit der Fernsehgeschichte gemacht habe, wollte ich wieder einen Blick in die Gegenwart wagen. Es hat sich nicht einfach nur gelohnt, es hat mich umgehauen. Es folgt ein kurzer Überblick über die Handlung und meine persönlichen Eindrücke, bei dem ich – wie immer – nur soviel über die Handlung vorwegnehme wie nötig, und so vage bleibe wie möglich. Aber die Spoilerwarnung möchte ich dennoch als ernstgemeint betrachtet wissen. Womöglich hat er unterschätzt, WIE schmutzig das Drogengeschäft eigentlich ist, denn sein Traum vom gemütlichen Doppelleben als der begnadete Methamphetamin-Koch „Heisenberg“ zerplatzt relativ früh, schließlich müssen da Zeugen, Konkurrenten und unkooperative ehemalige Geschäftspartner beseitigt werden, bevor man selbst beseitigt wird. Walter muss sein Leben täglich ein bisschen mehr aufs Spiel setzen, seine selbstgesetzten moralischen Grenzen immer ein bisschen weiter überschreiten, damit seine zweifelhafte Karriere nicht auffliegt. Den Schein des spießigen, ahnungslosen Familienvaters zu wahren, fällt schon bald immer schwerer, und dadurch bekommt sein Lügengebilde die ersten großen Risse. Dass sein eigener Schwager bei der DEA auch noch ohne es zu ahnen dicht auf seiner Spur ist, macht Walters Alltag zwischen Chemotherapie, Auftragskillern, Familie und Drogendealern umso verzwickter.
Womöglich hat er unterschätzt, WIE schmutzig das Drogengeschäft eigentlich ist, denn sein Traum vom gemütlichen Doppelleben als der begnadete Methamphetamin-Koch „Heisenberg“ zerplatzt relativ früh, schließlich müssen da Zeugen, Konkurrenten und unkooperative ehemalige Geschäftspartner beseitigt werden, bevor man selbst beseitigt wird. Walter muss sein Leben täglich ein bisschen mehr aufs Spiel setzen, seine selbstgesetzten moralischen Grenzen immer ein bisschen weiter überschreiten, damit seine zweifelhafte Karriere nicht auffliegt. Den Schein des spießigen, ahnungslosen Familienvaters zu wahren, fällt schon bald immer schwerer, und dadurch bekommt sein Lügengebilde die ersten großen Risse. Dass sein eigener Schwager bei der DEA auch noch ohne es zu ahnen dicht auf seiner Spur ist, macht Walters Alltag zwischen Chemotherapie, Auftragskillern, Familie und Drogendealern umso verzwickter.
 Es hätte eine so schöne Kindheit für Prinzessin Snow White (Kristen Stewart) werden können, wenn da nicht plötzlich ihre Mutter gestorben wäre. In der Folge heiratet ihr Vater, König Magnus, die geheimnisvolle Ravenna (Charlize Theron), die er zuvor aus den Fängen dunkler Krieger befreit hatte. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn Ravenna – jetzt Königin – ermordet kurzerhand ihren frisch angetrauten Gemahl, lässt Snow White in einen Turm sperren und reißt die alleinige Gewalt über das gesamte Land an sich. Als die Prinzessin eines Tages volljährig wird, erkennt Ravenna, welche Gefahr das Mädchen für sie darstellt. Doch kurz bevor Ravenna sie töten kann, gelingt es Snow White zu fliehen. Der Huntsman (Chris Hemsworth), ein stadtbekannter Trinker, soll sie aufspüren und zurückbringen, doch stattdessen beschließt er, sie zu beschützen, da sie die einzige ist, die die Schreckensherrschaft ihrer grausamen Stiefmutter beenden kann. Glücklicherweise stehen ihr außerdem ihr Jugendfreund William und einige Zwerge tapfer zur Seite, während Ravennas bösartiger Bruder der Truppe schon dicht auf den Fersen ist.
Es hätte eine so schöne Kindheit für Prinzessin Snow White (Kristen Stewart) werden können, wenn da nicht plötzlich ihre Mutter gestorben wäre. In der Folge heiratet ihr Vater, König Magnus, die geheimnisvolle Ravenna (Charlize Theron), die er zuvor aus den Fängen dunkler Krieger befreit hatte. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn Ravenna – jetzt Königin – ermordet kurzerhand ihren frisch angetrauten Gemahl, lässt Snow White in einen Turm sperren und reißt die alleinige Gewalt über das gesamte Land an sich. Als die Prinzessin eines Tages volljährig wird, erkennt Ravenna, welche Gefahr das Mädchen für sie darstellt. Doch kurz bevor Ravenna sie töten kann, gelingt es Snow White zu fliehen. Der Huntsman (Chris Hemsworth), ein stadtbekannter Trinker, soll sie aufspüren und zurückbringen, doch stattdessen beschließt er, sie zu beschützen, da sie die einzige ist, die die Schreckensherrschaft ihrer grausamen Stiefmutter beenden kann. Glücklicherweise stehen ihr außerdem ihr Jugendfreund William und einige Zwerge tapfer zur Seite, während Ravennas bösartiger Bruder der Truppe schon dicht auf den Fersen ist. Im England des 19. Jahrhunderts lebt der 18-jährige Tristan (Charlie Cox) in einem kleinen Dorf namens Wall. Dieses verdankt seinen Namen einer Steinmauer, die es von dem angrenzenden Königreich Stormhold abschirmen soll. Um die schöne Victoria (Sienna Miller) zu beeindrucken, beschließt Tristan einen gefallenen Stern zu finden und ihr als Geschenk zu bringen. Als er die Grenze zu Stormhold überquert und feststellt, dass der Stern eine junge Frau – Yvaine (Claire Danes) – ist, markiert das den Beginn einer fantastischen Reise voller Magie, auf der Suche nach Tristans Mutter und auf der Flucht vor der bösen Hexe Lamia (Michelle Pfeiffer), die Yvaine im Gegenzug für ewige Jugend töten will. Unterwegs geraten die beiden in die Fänge des berüchtigten Captain Shakespeare (Robert De Niro) und seiner Piratencrew. Und nicht zuletzt sind da noch die machtgierigen Thronfolger des Königreichs von Stormhold, die den Stern suchen um einen rechtmäßigen Erben bestimmen zu können.
Im England des 19. Jahrhunderts lebt der 18-jährige Tristan (Charlie Cox) in einem kleinen Dorf namens Wall. Dieses verdankt seinen Namen einer Steinmauer, die es von dem angrenzenden Königreich Stormhold abschirmen soll. Um die schöne Victoria (Sienna Miller) zu beeindrucken, beschließt Tristan einen gefallenen Stern zu finden und ihr als Geschenk zu bringen. Als er die Grenze zu Stormhold überquert und feststellt, dass der Stern eine junge Frau – Yvaine (Claire Danes) – ist, markiert das den Beginn einer fantastischen Reise voller Magie, auf der Suche nach Tristans Mutter und auf der Flucht vor der bösen Hexe Lamia (Michelle Pfeiffer), die Yvaine im Gegenzug für ewige Jugend töten will. Unterwegs geraten die beiden in die Fänge des berüchtigten Captain Shakespeare (Robert De Niro) und seiner Piratencrew. Und nicht zuletzt sind da noch die machtgierigen Thronfolger des Königreichs von Stormhold, die den Stern suchen um einen rechtmäßigen Erben bestimmen zu können. Mit der untreuen und promiskuitiven Tris hat sich der Highschool-Schüler und Musiker Nick offensichtlich die falsche Freundin ausgesucht. Um die kurz zuvor gescheiterte Beziehung zu retten, erstellt er dutzende Mix-CDs für Tris, die diese aber verächtlich wegwirft. Dafür begeistert sich die zunächst verschlossene Norah umso mehr für die CDs des unbekannten Musikkenners und schwärmt heimlich für ihn. Ein Zufall bringt die beiden auf einem Konzert zusammen, und was vielversprechend beginnt, stellt sich schnell als Reinfall heraus, weil Nick und Norah erkennen, dass sie sehr verschieden sind. Auf der ereignisreichen Suche nach Norahs verschollener betrunkener Freundin Caroline und nach einem Geheimkonzert der gemeinsamen Lieblingsband „Where’s Fluffy?“ scheint es mit etwas Verspätung doch noch zu funken. Und auf einmal will Tris sich wieder mit Nick versöhnen.
Mit der untreuen und promiskuitiven Tris hat sich der Highschool-Schüler und Musiker Nick offensichtlich die falsche Freundin ausgesucht. Um die kurz zuvor gescheiterte Beziehung zu retten, erstellt er dutzende Mix-CDs für Tris, die diese aber verächtlich wegwirft. Dafür begeistert sich die zunächst verschlossene Norah umso mehr für die CDs des unbekannten Musikkenners und schwärmt heimlich für ihn. Ein Zufall bringt die beiden auf einem Konzert zusammen, und was vielversprechend beginnt, stellt sich schnell als Reinfall heraus, weil Nick und Norah erkennen, dass sie sehr verschieden sind. Auf der ereignisreichen Suche nach Norahs verschollener betrunkener Freundin Caroline und nach einem Geheimkonzert der gemeinsamen Lieblingsband „Where’s Fluffy?“ scheint es mit etwas Verspätung doch noch zu funken. Und auf einmal will Tris sich wieder mit Nick versöhnen.